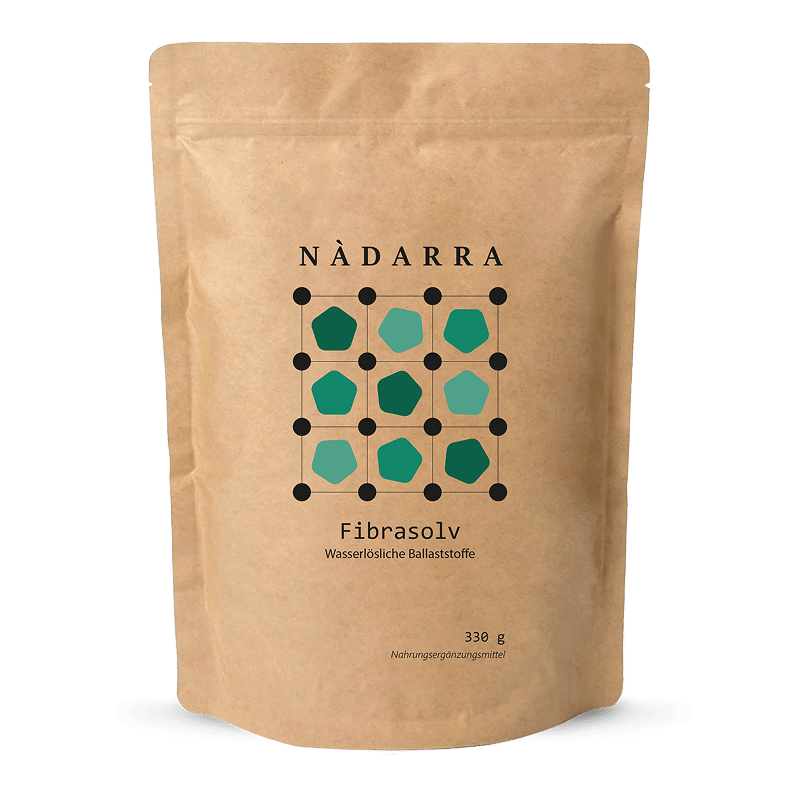Ballaststoffe (manchmal auch Fasern genannt) gehören zur Gruppe der Kohlenhydrate und bestehen aus für den Menschen unverdaulichen Pflanzenbestandteilen. Sie sind nicht essenziell, können jedoch unseren “guten” Bakterien als Nahrung dienen, und das Darmmikrobiom auf diese Weise positiv beeinflussen. Anders als der Name vielleicht vermuten lässt sind sie nämlich kein „Ballast“, sondern im Gegenteil: Sie regulieren die Verdauung auf vielfältige Art, können das Risiko für bestimmte Erkrankungen beeinflussen und dadurch ein entscheidender Hebel für mehr (Darm-)Gesundheit sein. [1, 2]
Was sind Ballaststoffe?
Ballaststoffe sind komplexe Kohlenhydrate pflanzlichen Ursprungs, die vom menschlichen Dünndarm nicht aufgeschlossen werden können. Dazu zählen z.B. Cellulose aus pflanzlichen Zellwänden (Gemüse), Pektine (aus Apfel) und Beta-Glucane (aus Haferfasern), aber auch resistente Stärke (kalte Kartoffeln oder Nudeln) oder Lignin (Holzfaser aus Vollkornprodukten). Obwohl Ballaststoffe keine Energie liefern, entfalten sie weitreichende physiologische Wirkung im Verdauungstrakt und darüber hinaus. [1, 3]
Durch ihre Unverdaulichkeit und die Eigenschaft, Wasser zu binden, beeinflussen Ballaststoffe vor allem Masse und Konsistenz des Stuhls. Dadurch kann die Transitzeit der Nahrung im Darm sowie die Häufigkeit der Darmentleerung gefördert oder vermindert werden – je nach Ausgangslage.
Sie beeinflussen außerdem die Sättigungswirkung, den Blutzuckerspiegel sowie die Nährstoffabsorption und haben eine wichtige präbiotische Wirkung im Darm. Auf diese Weise können sie die Etablierung und das Wachstum der “guten” Bakterien aktiv fördern. Ballaststoffe haben insgesamt schützende Effekte in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, Adipositas, Bluthochdruck, Dickdarm- und Brustkrebs sowie das Sterblichkeitsrisiko. [1, 2, 4]
Lösliche und unlösliche Ballaststoffe
Ballaststoffe lassen sich in zwei Hauptgruppen einteilen. Wasserlösliche Ballaststoffe sind in der Regel fermentierbar und liefern Nahrung für unsere guten Darmbakterien. Unlösliche Ballaststoffe sind nur geringfügig fermentierbar, das heißt sie können selbst von unseren Darmbakterien nicht verdaut werden. Sie erhöhen dadurch aber das Stuhlvolumen und beeinflussen so die Dauer der Darmpassage und die Stuhlbeschaffenheit. [5]
Lösliche Ballaststoffe Hierzu zählen z. B. Pektin (aus Apfel), Akazienfaser, Beta-Glucane (aus Hafer), Inulin (aus Chicorée) oder auch Flohsamenschalen. Sie lösen sich in Wasser und bilden dadurch visköse Gele. Dies hat gleich zwei Effekte: zum einen wird die Nahrung gleitfähiger gemacht, was den Verdauungsprozess unterstützt. Zum anderen sorgen sie durch das leichte Aufquellen im Magen auch für ein längeres Sättigungsgefühl und vermeiden Blutzuckerspitzen nach dem Essen, da die in der Nahrung enthaltenen Kohlenhydrate langsamer in den Dünndarm gelangen, dort aufgespalten und als Zucker ins Blut abgegeben werden. Vor allem aber können lösliche Ballaststoffe zwar nicht von uns direkt, aber von unseren Darmbakterien fermentiert, also verdaut werden. Bei dieser bakteriellen Verdauung entstehen Stoffwechselprodukte wie z.B. kurzkettige Fettsäuren, vor allem Acetat, Propionat und Butyrat [6]. Diese Stoffe fördern das Wachstum von Bifidobakterien und Laktobazillen und verdrängen so potenziell pathogene Keime [6, 7]. Dadurch beeinflussen lösliche Ballaststoffe direkt die Zusammensetzung des Mikrobioms und auf diese Weise auch unser Immunsystem.
Unlösliche Ballaststoffe Hierzu zählen z. B. Cellulose (Vollkorn, Gemüse) oder Lignin (Holzfaser, Schalen von Getreidekörner) und auch Flohsamenschalen haben 20-30 % unlösliche Anteile. Sie binden weniger Wasser als lösliche Ballaststoffe und wirken eher mechanisch, da sie vor allem das Stuhlvolumen erhöhen. Sie werden der Bezeichnung “Ballaststoffe” als am ehesten gerecht. Durch die Erhöhung des Stuhlvolumens verstärkt sich auch der Druck auf die Darmwand. Dies wiederum regt über drucksensible Nerven im Darm die Peristaltik an und beschleunigt die Darmpassage. [5]
Präbiotika und Probiotika
Im Dschungel der Darmgesundheit stößt man unweigerlich immer wieder über diese beiden Begriffe. Unter Probiotika versteht man die Darmbakterien an sich. Bei manchen Indikationen werden diese auch gezielt eingesetzt, z.B. in Präparaten mit bestimmten Bakterienstämmen. Während oder nach einer antibiotischen Behandlung kann dies z.B. sinnvoll sein. Gegenstand der Forschung ist u.a. ob sich die Probiotika tatsächlich im Darm ansiedeln und vermehren oder eher einen temporären Effekt während der Einnahme haben. Neben den Probiotika gibt es aber auch Präbiotika. Sie dienen den Darmbakterien als Ausgangssubstrat, also als Nahrung. Ballaststoffe zählen daher zu den Präbiotika. Wenn unsere Darmbakterien Ballaststoffe verdauen, entstehen bestimmte Stoffwechselprodukte, die förderlich für unsere Darmgesundheit sind (s. vorheriger Absatz). Es gibt auch Präparate, die Prä- und Probiotika zusammen liefern. Diese nennt man dann “Synbiotika”, da sie Prä- und Probiotika direkt ergänzen. Eine gemeinsame Einnahme kann oft sinnvoll sein, ist aber nicht zwingend erforderlich. [7]
Zufuhrmengen und Versorgung in der Bevölkerung
Die allgemeine Zufuhrempfehlung der DGE beläuft sich auf 30 g Ballaststoffe pro Tag. Diese werden jedoch laut Nationaler Verzehrsstudie von 68 % der Männer und 75 % der Frauen nicht erreicht. [8]
Vielleicht überraschen Dich diese Zahlen, denn gesundheitsbewusste Ernährung wird im Allgemeinen eher den Frauen zugeschrieben. Berechnet man den Ballaststoffgehalt pro Kalorie, zeigt sich, dass Frauen pro Kalorieneinheit zwar mehr Ballaststoffe konsumieren als Männer – etwa um 28 % höher (Frauen 16 g BS pro 1000 kcal, Männer 12,5 BS pro 1000 kcal). Dennoch ist die absolute Ballaststoffzufuhr bei Frauen wegen ihres geringeren Gesamtenergiebedarfs weiterhin niedriger (Median 23 g/Tag vs. 25 g/Tag bei Männern.
Ballaststoffquellen in der Ernährung
Eine vielseitige, pflanzenbasierte Ernährung mit Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Gemüse, Obst und Saaten liefert automatisch eine breite Palette an Ballaststoffen (siehe Tabelle) [1]. Die Empfehlung von 30 g Ballaststoffen kann daher im Allgemeinen gut über die Ernährung abgedeckt werden, sofern diese reich an pflanzlichen Bestandteilen ist. Dennoch fällt es vielen Menschen im Alltag schwer, diese Mengen an Gemüse und Vollkorn zu sich zu nehmen. Auch bei bestimmten Indikationen macht die (zusätzliche) Einnahme eines speziellen Ballaststoffprodukts Sinn.
Tabelle 1: Ballaststoffreiche Lebensmittel [1, 9, 10]
| Lebensmittel | Gehalt in g / 100 g |
|---|---|
| Apfel mit Schale | 2,0 g |
| Karotten | 2,8 g |
| Brokkoli | 3,1 g |
| Kichererbsen (gekocht) | 7,6 g |
| Vollkornbrot (Roggen) | 8 g |
| Gekochte Linsen | 8 g |
| Haferflocken | 10 g |
| Mandeln | 12 g |
| Chiasamen | 34 g |
| Leinsamen | 22 g |
Ballaststoffe bei spezifischen Indikationen
Hypercholesterinämie
Lösliche Ballaststoffe wie Beta‑Glucane aus Hafer oder Gerste bilden im Magen–Darm‑Trakt ein zähes Gel, das Gallensäuren bindet und deren Wiederaufnahme verhindert. Die Leber muss daraufhin vermehrt Cholesterin in Gallensäuren umwandeln, wodurch der LDL‑Cholesterinspiegel im Blut sinkt [11]. Bereits 3 g Beta-Glucan täglich zeigen messbare Effekte (3, 12).
Diabetes mellitus Typ 2
Lösliche Ballaststoffe erhöhen die Viskosität im Magen-Darm-Trakt, was die Magenentleerung verlangsamt und so die schnelle Freisetzung von Zucker ins Blut verhindert. Dadurch können postprandiale (= nach der Mahlzeit) Blutzuckerspitzen abflachen und die Insulinsensitivität verbessert werden [13]. Daher wundert es nicht, dass ein hoher Ballaststoffanteil in der Kost mit einem reduzierten Diabetesrisiko assoziiert ist [14].
Reizdarmsyndrom und Obstipation (IBS-C)
Die Wirkung von Ballaststoffen bei Personen mit Reizdarmsyndrom (IBS) ist individuell sehr unterschiedlich und sollte daher immer als Einzelfall betrachtet werden. Therapeutische Empfehlungen variieren je nach dominierendem Symptom:
- Bei IBS-Typen mit Durchfall (IBS-D) oder gemischten Beschwerden (IBS-M) sollten Ballaststoffe – wenn überhaupt – nur sehr vorsichtig ergänzt werden. Insbesondere unlösliche Ballaststoffe (z. B. Kleie, auch Flohsamenschalen) können die Stuhlhäufigkeit erhöhen und Symptome verschlimmern. Ballaststoffe sollten daher sehr vorsichtig und zunächst niedrig dosiert eingenommen werden. [15]
- Bei IBS-C (mit dem Leitsymptom der Obstipation) gelten Ballaststoffe häufig als erste therapeutische Maßnahme. Sie binden Wasser, verbessern die Stuhlkonsistenz, erhöhen das Stuhlvolumen und erleichtern die Darmentleerung. In den internationalen Leitlinien gelten Ballaststoffe als effektives Mittel der Wahl bei Reizdarmsyndrom mit Obstipation als Leitsymptom. Lösliche und viskose Ballaststoffe wie Flohsamenschalen sind besonders wirksam und verträglich. [16-18] Wichtig ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, da die Verstopfungsneigung sonst eher begünstigt wird.
Darmgesundheit und Mikrobiom
Fermentierbare Ballaststoffe – vor allem lösliche Fasern wie Inulin, Pektine oder Beta-Glucane – dienen bestimmten Bakteriengruppen im Darm (z. B. Bifidobakterien, Laktobazillen, Faecalibacterium prausnitzii) als Substrat. Der bakterielle Abbau führt zur Bildung von kurzkettigen Fettsäuren (SCFA=short chain fatty acids): Acetat, Propionat und Butyrat. Diese Metabolite haben weitreichende Schutzfunktionen: [6, 19, 20]
- Butyrat ist die bevorzugte Energiequelle für die Darmepithelzellen (Zellen der Darmwand). Es stärkt die Barrierefunktion der Darmschleimhaut, indem es die Bildung von so genannten Tight Junction-Proteinen stimuliert. Eine intakte Darmbarriere ohne Lücken verhindert, dass Bakterienbestandteile in den Blutkreislauf gelangen und dort z.B. stille Entzündungen fördern.
- Propionat wirkt in der Leber: Es hemmt die Cholesterinsynthese und beeinflusst die Glukoseproduktion, was sich günstig auf Blutfette und Blutzucker auswirkt.
- Acetat ist die am häufigsten gebildete SCFA und dient peripheren Geweben (z. B. Muskeln) als Energiequelle. Zudem beeinflusst es über Rezeptoren (FFAR2/3) das Immunsystem und die Appetitregulation.
Darüber hinaus wirken kurzkettige Fettsäuren entzündungshemmend, indem sie die Bildung von pro-inflammatorischen Zytokinen bremsen und die Aktivität regulatorischer T-Zellen fördern. Studien zeigen, dass eine ballaststoffreiche Ernährung mit höherer SCFA-Produktion mit einem geringeren Risiko für chronische Darmentzündungen, Darmkrebs, Adipositas, Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen assoziiert ist [20].
Verträglichkeit und Nebenwirkungen
Eine Erhöhung der Ballaststoffzufuhr sollte idealerweise schrittweise erfolgen, da sich der Verdauungstrakt erst an die veränderte Zusammensetzung der Nahrung gewöhnen muss. Wird die Menge zu schnell gesteigert oder zu wenig getrunken, können vorübergehend Blähungen, Völlegefühl oder auch eine trägere Verdauung auftreten. Mit einer langsamen Anpassung und ausreichender Flüssigkeitszufuhr lassen sich diese Effekte jedoch gut vermeiden.
Fazit
Ballaststoffe sind für eine gesunde Ernährung unentbehrlich. Sie wirken positiv auf Stoffwechsel, Verdauung und Mikrobiom und können gezielt zur Prävention oder Therapie verschiedener Erkrankungen eingesetzt werden. Eine abwechslungsreiche, pflanzenreiche Kost ist der einfachste Weg, um den Bedarf zu decken und von den vielfältigen gesundheitlichen Vorteilen zu profitieren.
[1] Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE). Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr: Ballaststoffe. Bonn: DGE; 2020.
[2] Reynolds A, Mann J, Cummings J, Winter N, Mete E, Te Morenga L. Carbohydrate quality and human health: a series of systematic reviews and meta-analyses. Lancet. 2019;393(10170):434–45.
[3] EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). Scientific Opinion on Dietary Reference Values for carbohydrates and dietary fibre. EFSA Journal. 2010;8(3):1462.
[4] Brown L, Rosner B, Willett WW, Sacks FM. Cholesterol-lowering effects of dietary fiber: a meta-analysis. Am J Clin Nutr. 1999;69(1):30–42.
[5] Slavin JL. Dietary fiber and body weight. Nutrition. 2005;21(3):411–8.
[6] Koh A, De Vadder F, Kovatcheva-Datchary P, Bäckhed F. From dietary fiber to host physiology: short-chain fatty acids as key bacterial metabolites. Cell. 2016;165(6):1332–45.
[7] Slavin JL. Fiber and prebiotics: mechanisms and health benefits. Nutrients. 2013;5(4):1417–35.
[8] Max Rubner-Institut (MRI). Nationale Verzehrsstudie II, Ergebnisbericht Teil 2. Karlsruhe: MRI; 2008.
[9] Souci SW, Fachmann W, Kraut H. Die Zusammensetzung der Lebensmittel. 8. Aufl. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2016.
[10] BMEL. Bundeslebensmittelschlüssel (BLS). Version 3.02. Bonn: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft; 2020.
[11] Heart UK. Oats and barley: cholesterol-lowering foods. 2022. Verfügbar unter: https://www.heartuk.org.uk/four-cholesterol-lowering-foods/oats-and-barley
[12] EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). Scientific Opinion: Oat beta-glucan and lowering blood cholesterol. EFSA Journal. 2010;8(12):1885.
[13] Silva FM, Kramer CK, de Almeida JC, Steemburgo T, Gross JL, Azevedo MJ. Fiber intake and glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials. Nutr Rev. 2013;71(12):790–801.
[14] Chandalia M, Garg A, Lutjohann D, von Bergmann K, Grundy SM, Brinkley LJ. Beneficial effects of high dietary fiber intake in patients with type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med. 2000;342(19):1392–8.
[15] DGVS/DGNM. S2k-Leitlinie Chronische Obstipation bei Erwachsenen. AWMF-Registernr. 021-019. 2022.
[16] Lacy BE, et al. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021;116(1):17–44.
[17] Ford AC, et al. Efficacy of soluble fibre in IBS: systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2014;109(9):1367–74.
[18] Mayo Clinic. The role of lifestyle-related treatments for IBS. 2020. Verfügbar unter: https://www.mayoclinic.org/medical-professionals/digestive-diseases/news/the-role-of-lifestyle-related-treatments-for-ibs/mac-20431272
[19] Canfora EE, Jocken JW, Blaak EE. Short-chain fatty acids in control of body weight and insulin sensitivity. Nat Rev Endocrinol. 2015;11(10):577–91.
[20] Parada Venegas D, De la Fuente MK, Landskron G, et al. Short chain fatty acids (SCFAs)-mediated gut epithelial and immune regulation and its relevance for inflammatory bowel diseases. Front Immunol. 2019;10:277.